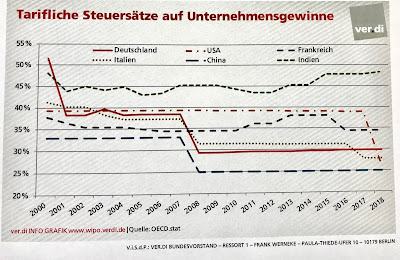Sicherlich auch für euch überraschend,
gab es im Rahmend der Beratung des Nachtragshaushalts im Bundestag auch auf
einmal einen Posten zur Verlagsförderung mit insgesamt 220 Mio. Euro Förderung
über mehrere Jahre.
Dazu hat ver.di eine Pressemitteilung herausgebracht, die für die weitere Ausgestaltung der Förderrichtlinien, die jetzt ansteht, klare Orientierung der Zuwendung an Kriterien fordert. Kriterien die dazu führen, dass auch die Beschäftigten in Verlagen etwas davon haben, wenn Digitalisierung gefördert wird
„Wer von
öffentlichen Geldern profitieren will, der muss auch die Einhaltung tariflicher
Standards, gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung nachweisen“,
Pressemitteilung vom 02.07.2020
Die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert klare Kriterien und Bedingungen
für die Verteilung der vom Deutschen Bundestag beschlossenen staatlichen
Fördergelder für Verlage in Höhe von insgesamt 220 Millionen Euro. „Wer von
öffentlichen Geldern profitieren will, der muss auch die Einhaltung tariflicher
Standards, gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung nachweisen“,
sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz am Donnerstag.
Voraussetzung für die Gewährung von
Unterstützungsgeldern müsse die Offenlegung der wirtschaftlichen Kennzahlen
durch die Verlage sein. Die Förderung solle nach fairen Kriterien verteilt
werden und dürfe nicht an der falschen Stelle landen. „Es darf nicht sein, dass
Verlage, denen es verhältnismäßig gut geht, unter dem Deckmantel des
Tendenzschutzes Gelder einstreichen, die andere viel dringender benötigen“,
stellte Schmitz klar.
Größtmögliche Transparenz und Unabhängigkeit forderte er zudem hinsichtlich der zu bestimmenden Verteilstrukturen: „Um ihrem Auftrag der Kontrolle staatlicher Macht nachkommen zu können, müssen Medien auch frei von jeglicher staatlichen Einflussnahme arbeiten können.“ Dies gelte es bei der Verteilung der Bundesgelder zu berücksichtigen, mahnte Schmitz.
Größtmögliche Transparenz und Unabhängigkeit forderte er zudem hinsichtlich der zu bestimmenden Verteilstrukturen: „Um ihrem Auftrag der Kontrolle staatlicher Macht nachkommen zu können, müssen Medien auch frei von jeglicher staatlichen Einflussnahme arbeiten können.“ Dies gelte es bei der Verteilung der Bundesgelder zu berücksichtigen, mahnte Schmitz.